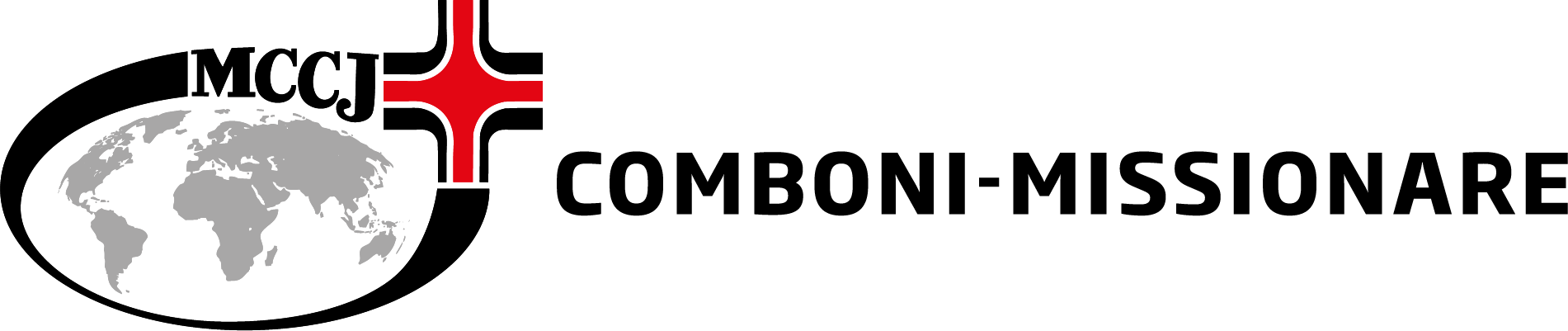Nach ihrer ersten Missionserfahrung in Peru wurde sie nach Tapachula in Chiapas im Süden Mexikos berufen, um mit Migranten zu arbeiten, die hauptsächlich aus Mittelamerika und Haiti kommen. Sr. Maria Reina Ametepé, eine togolesische Comboni-Schwester, steht vor neuen Herausforderungen.
Ursprünglich stamme ich aus der Pfarrei Adidogome (Togo), in der die Comboni-Missionare und die Comboni-Schwestern tätig sind. Im Alter von 13 Jahren wurde ich getauft. Meine Patentante fragte mich, ob ich Ordensschwester werden wolle, aber damals wusste ich nicht einmal, was es bedeutet, eine Schwester zu sein, und ich sagte nichts. Später lud mich ihr Neffe ein, an der Berufungsgruppe der Pfarrei teilzunehmen, und ich begann, gelegentlich dorthin zu gehen. Die Missionare kamen, um ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Nach und nach stellte ich mich selbst in Frage und fragte Gott: „Was soll in Zukunft aus mir werden?
Als ich mein Abitur machte, das zum Studium berechtigt, fragte mich eine Comboni-Schwester, worauf ich noch warten würde, bevor ich mich entscheide, in eine Ordensgemeinschaft einzutreten. Ich sagte ihr, dass die Zeit noch nicht reif sei, und nahm an Exerzitien im Zentrum für missionarische Bewusstseinsbildung der Comboni-Missionare teil. Dort fragte ich, als ich kurz vor dem Beginn meines Studiums stand, den Herrn erneut: „Was willst du, dass ich mit meinem Leben anfange?“ In der Kapelle der Comboni-Missionare gab es ein Bild des heiligen Daniel Comboni, und während eines Moments der Anbetung vor dem Allerheiligsten stieß ich darauf und war von seinem Blick beeindruckt.
Ich hatte einige Bücher über sein Leben gelesen, und die Comboni-Missionare hatten uns von ihm erzählt. Ich erfuhr, dass er das einzige überlebende Kind seiner Familie war und dass er sein Leben der Hilfe für die Afrikaner gewidmet hatte. Immer wieder schaute ich auf das Foto und den Blick, und am Ende fing ich an zu weinen. Ich weiß nicht, was über mich kam. Im Jahr 2007 begann ich meinen Berufungsweg bei den Comboni-Schwestern. Am vierten Sonntag der Osterzeit, dem Welttag der Berufungen, hat mich der Text aus dem Evangelium sehr beeindruckt, in dem es heißt: „Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter“.
Ich begann, mich von anderen Menschen begleiten zu lassen, und das half mir, meine Berufung nach und nach zu entdecken. Ich habe auch in verschiedenen Gruppen mitgewirkt, als Animatorin, Koordinatorin oder Sekretärin, und das hat mich ermutigt, ein Vorbild zu sein und meiner Berufung Gestalt zu geben. Meine Mutter sagte mir immer: „Bleib in der Pfarrei, sag dem Priester, er soll dir eine Unterkunft geben, dann kannst du dort bleiben“, denn ich war immer in die Aktivitäten der Pfarrei eingebunden. Ich begann zu verstehen, dass mein Glück in der Ausübung von Tätigkeiten im Dienste des Herrn lag, und ich erkannte, dass ich mehr Zeit haben würde, anderen zu dienen, wenn ich mein Leben Gott weihen würde. Dies und das Comboni-Motto „Afrika mit Afrika retten“ waren der Auslöser für meine Entscheidung, ein afrikanisches Instrument zu werden, um meinen afrikanischen Brüdern und Schwestern zu helfen. Nach fünf Jahren der Begleitung durch die Comboni-Schwestern und einem Abschluss in Bildungssoziologie trat ich in der Demokratischen Republik Kongo in das Postulat ein. Dann machte ich mein Noviziat in Uganda.
Nachdem ich die Zeitlichen Gelübde abgelegt hatte, wurde ich im Oktober 2017 nach Ecuador geschickt, um Spanisch zu lernen, und im Juni 2018 nach Peru versetzt. Dort arbeitete ich zunächst in einem sozialen Bildungsprojekt der Jesuiten, das jungen Menschen, die die Sekundarschule nicht abschließen konnten, eine Grundausbildung bot. Wir befanden uns in den Außenbezirken von Lima, einem Gebiet, das stark von Menschen aus allen Regionen des Landes bevölkert ist, die vor Gewalt oder Terrorismus fliehen. Die Menschen dort leben von schlecht bezahlten Jobs, und wenn die Kinder von der Schule nach Hause zurückkommen, sind ihre Eltern sind nicht da, weil sie arbeiten müssen. Viele leben auf der Straße. Das Programm „Casita“ hatte zum Ziel, diese Kinder aufzufangen und ihnen bei den Hausaufgaben zu helfen, Workshops zum Thema Selbstwertgefühl zu organisieren usw. Ich besuchte die Familien, um zu sehen, wie sie leben. Nach und nach öffneten sich die Menschen und erzählten mir von ihren Sorgen und Ängsten. Auf der Grundlage dessen, was sie mir berichteten, entwickelte ich die Schulungsthemen. Jedes Jahr im Sommer unterrichtete ich Katechisten in einem Missionskunde-Kurs, der auf kirchlichen Dokumenten basierte.
Auch mit der Caritas habe ich zusammengearbeitet, indem ich Kranke besuchte und während der Pandemiezeit mit den so genannten „geteilten Töpfen“ Lebensmittel für viele Menschen zubereitete. Im Dezember 2022 reiste ich nach Italien, um mich auf meine Ewigen Gelübde vorzubereiten, die ich am 2. September in meiner Gemeinde in Togo ablegte. Während der Vorbereitung lernte ich zwei mexikanische Schwestern kennen, die ebenfalls ihre Ewigen Gelübde ablegten. Später kehrte ich nach Peru zurück. Ich war glücklich, die Erfahrung „Afrika mit Afrika retten“ in Peru machen zu können. Ich hatte gehofft, in meinem eigenen Afrika zu bleiben, aber ich habe Afrika in Peru gefunden, und in den Menschen dort habe ich den Grund gefunden, warum ich mein Leben Gott geweiht habe.
Mit meinem neuen Auftrag in Tapachula, Chiapas, habe ich das Gefühl, neu anfangen zu müssen; es ist eine neue Aufgabe mit neuen Menschen in einer anderen Situation. Man hat mir gesagt, dass Tapachula eine Gemeinde ist, die offen für die Arbeit mit Migranten ist. Ich bin bereit dafür, zu entdecken, was der Herr von mir will. Für mich ist das eine große Herausforderung, und manchmal fühle ich mich auch hilflos, weil ich nicht in der Lage bin, all das zu erfüllen, was von mir verlangt wird. Ich weiß noch nicht, was meine Aufgabe sein wird, denn ich schließe auch einige Studien ab und muss von Zeit zu Zeit zu Vorlesungen nach Guadalajara fahren. Für mich ist es wichtig, dass ich mich nach und nach in die Realität einarbeite und das Gemeinschaftsprojekt kennenlerne, um zu sehen, wie ich am besten helfen kann. Das Einzige, was ich von mir verlange, ist, offen zu sein und zu sehen, was ich anbieten oder geben kann.
Ich gehe mit dem großen Wunsch zu lernen und mit viel Freude. Neue Gegebenheiten wie Tapachula erfordern Zeit, um den Menschen, der Gemeinschaft und mir selbst zuzuhören; einen Raum zum Lernen. Ich brauche Zeit, um zu beobachten und mich von den Menschen belehren zu lassen. Es ist der Herr, der mich schickt, und ich stelle mich ihm zur Verfügung. Ich habe diese Veränderung nicht erwartet, aber wie man in Peru sagt, „es gibt immer einen Grund“, und ich bin froh, dass ich unterwegs bin. Gottes Wege sind nicht unsere Wege, wir müssen uns ihm mit Offenheit zur Verfügung stellen.