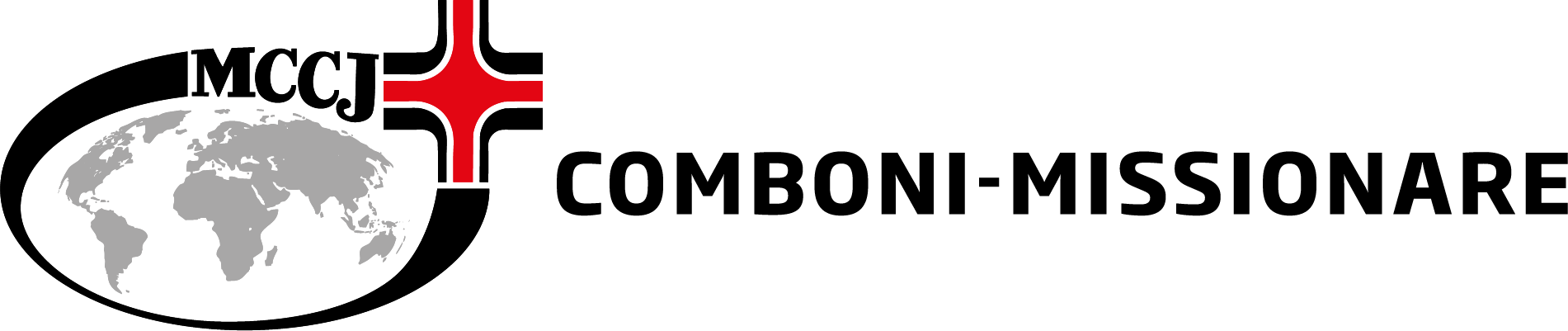Die interkapituläre Versammlung der Comboni-Missionare fand vom 7. bis 26. September im Generalat in Rom statt. Sie endete gestern mit einer Eucharistiefeier unter dem Vorsitz von Pater Luigi Codianni [Bild], dem Generaloberen. Zu seinen Mitbrüdern sagte er: „Die Zukunft hängt von unserer Integrität ab. Verantwortung zu übernehmen ist ein Zeichen von Stärke, nicht von Schwäche. Wenn wir mit Integrität handeln, gewinnen wir Vertrauen und die Fähigkeit zurück, ein moralisches Leuchtfeuer zu sein“. Und er betonte: „Neben Mut brauchen wir auch die Überzeugung, dass der Auftrag unseres Instituts nach wie vor wichtig ist, dass er nach wie vor eine entscheidende Rolle spielt und dass er es wert ist, auch auf unerwartete Weise erfüllt zu werden.“ Wir veröffentlichen die Predigt nachstehend.

Predigt von Pater Luigi Codianni
bei der Abschlussmesse des Zwischenkapitels in Rom
Die biblischen Lesungen der heutigen Liturgie haben mir vier kurze Sätze nahegelegt, die zusammenfassen können, was wir in den letzten Tagen diskutiert haben, und die zusammengenommen eine starke Ermutigung darstellen können, „das Feuer der Mission neu zu entfachen“, das wir brauchen, wenn wir die Herausforderung unserer zukünftigen Arbeit bewältigen wollen.
- Der Prophet Haggai [Hag 1,15b-2,9] in der ersten Lesung leiht Gott seine Stimme, der uns auffordert: „Habt Mut, lasst uns an die Arbeit gehen… Ich bin mit euch… Habt keine Angst“.
Durch den Mund des Haggai fordert Gott sein Volk auf, den Bau des Tempels trotz der vielen Schwierigkeiten fortzusetzen. Seine Worte sind vollkommen, auch wenn wir sie als an uns heute gerichtet betrachten: „Habt Mut, lasst uns an die Arbeit gehen … Ich bin mit euch … fürchtet euch nicht“.
Auch wir, die wir uns auf die Rückkehr in unsere Wahlkreise vorbereiten, fühlen uns ermutigt, die zahlreichen Herausforderungen, die vor uns liegen, mutig anzugehen.
In den verschiedenen Berichten, die wir in der Versammlung gehört haben, wurden „schöne und ermutigende Geschichten“ erzählt, und es wurden Initiativen und Projekte aufgezählt, die voller Enthusiasmus und Dynamik sind und zum Teil bereits von positiven Ergebnissen gekrönt werden.
Wir müssen hier ansetzen, bei dem Positiven, das es bereits gibt. Die Geschichte darf nicht vergessen werden. Wir müssen unserem Charisma treu bleiben und stolz sein auf das viele Gute, das im Sinne unserer ureigensten Tradition getan worden ist.
Gleichzeitig wollen wir bereit sein, die neuen Herausforderungen anzunehmen und die Chancen zu ergreifen, die uns diese sich ständig verändernde Welt bietet.
Wir brauchen jedoch den Mut, zu erkennen, dass sich die Welt verändert. Hier liegt der erste – und vielleicht schwierigste – Akt des Mutes, den wir vollziehen müssen: anzuerkennen, dass sich die Welt verändert hat. Wir können nicht so tun, als würden wir das Neue, das sich anbahnt, nicht sehen und akzeptieren. Sich in Nostalgie zu verschließen, ist sicherlich keine „Combonian“-Haltung.
Wir brauchen auch den Mut zum Zuhören und zum Dialog. Lassen Sie uns zu Menschen werden, die an den Dialog glauben und das Bedürfnis verspüren, die Kunst des Dialogs besser zu erlernen. Eine Kunst, die Demut und den Mut beinhaltet, unsere Verletzlichkeit und Unvollkommenheit zu akzeptieren. Nur so können wir echte Beziehungen zu anderen aufbauen, uns selbst gut fühlen und stärker und authentischer sein. Wir erkennen an, dass wir nicht alle Antworten parat haben. Durch einen aufrichtigen und respektvollen Dialog bereichern wir unser Verständnis der Realität und lernen, Brücken statt Mauern zu bauen.
Gleichzeitig brauchen wir den Mut, integer zu handeln. Die Zukunft hängt von unserer Integrität ab. Verantwortung zu übernehmen ist ein Zeichen von Stärke, nicht von Schwäche. Wenn wir mit Integrität handeln, gewinnen wir Vertrauen und die Fähigkeit zurück, ein moralisches Leuchtfeuer zu sein.
Neben Mut brauchen wir auch die Überzeugung, dass der Auftrag unseres Instituts nach wie vor wichtig ist, dass er nach wie vor eine entscheidende Rolle spielt und dass er es wert ist, auch auf unerwartete Weise erfüllt zu werden.
2. Die Herausforderung, vor der das Volk Israel zur Zeit Haggais stand, war der Bau des Tempels. Unsere Herausforderung heute lautet: „Habt Mut … lasst uns echte Gemeinschaften bauen“.
Ein Werk, das Gott von uns verlangt, ist immer anspruchsvoll. Er hat in der Geschichte viele gefordert. Warum sollte er das nicht auch von uns heute verlangen? Und wenn Gott uns bittet, sollten wir uns nicht von der Größe der geforderten Arbeit abschrecken lassen, sondern auf seine unerschütterliche Verheißung hören: „Sei stark, denn ich bin bei dir“.
Lasst uns nicht bei Null anfangen. Die Geschichte des Instituts ist eine fantastische Plattform, um etwas Neues zu beginnen.
Die „wahren Gemeinschaften“, von denen ich spreche – und die wir alle anstreben – müssen die Vergangenheit nicht nachahmen: Sie müssen sie nur respektieren. Schätzen wir die Lektionen, die wir gelernt haben, bewahren wir die überlieferte Weisheit, rühmen wir uns auch der Erfolge, die wir erzielt haben … aber wir wollen ein „anderes“ und ebenso großartiges Morgen aufbauen.
3. Was verstehen wir unter „echten“ Gemeinschaften?
Im gelesenen Evangelium [Lk 9,18-22] ist Jesus im Gebet und die Jünger sind bei ihm. Das Gebet (als Dialog mit Gott) und die Brüderlichkeit sind trotz unserer vielen Grenzen zwei unabdingbare Voraussetzungen für diejenigen, deren Aufgabe es ist, eine Gemeinschaft zu beleben.
Ich würde sagen, dass die „neuen“ Gemeinschaften, die wir aufbauen wollen, die folgenden drei Merkmale ganz oben auf ihrer Prioritätenliste haben müssen: Sie müssen „Gemeinschaften“ sein, die vom Gebet genährt werden, die von echter „Brüderlichkeit“ geprägt sind und die international und interkulturell sind.
a) Der Text des heutigen Evangeliums beginnt damit, dass Jesus sich zurückzieht, um allein zu beten. Im Lukasevangelium wird Jesus oft im Gebet gezeigt, besonders bevor er wichtige Entscheidungen trifft oder bedeutende Initiativen einleitet.
Das Gebet Jesu ist keine bloße Routine, sondern eine innige Gemeinschaft mit dem Vater: „Ich tue immer das, was ihm gefällt“ (Joh 8,29). Auch unser Gebet muss ein ständiger Dialog mit Gott sein.
Dieses Mal betet Jesus vor einem grundlegenden Moment im Abenteuer der Apostel. Jesus fordert sie auf, eine Bestandsaufnahme ihrer Nachfolge zu machen: „Wer sagt ihr, dass ich bin?“. Er zwingt sie, sich gegenseitig zu befragen und zu konfrontieren, um dann zu entscheiden, was sie tun sollen.
Der Herr fordert auch uns auf, innezuhalten und nachzudenken und nichts für selbstverständlich zu halten. In der Stille des Gebets müssen wir die lebendige Gegenwart“ des Meisters in unserem heutigen Leben neu verorten. Was gestern noch gut war, ist heute vielleicht nicht mehr gut.
b) Wenn wir „neue Gemeinschaften aufbauen“ wollen, dann müssen wir alle zu Liebhabern der Gemeinschaft und all dessen werden, was das gemeinsame Leben – also das „Zusammenleben“ – mit sich bringt. Niemand kann sich davon freisprechen, seine Rolle zu spielen.
Die Gemeinschaften, die wir aufbauen wollen, müssen von echter Koexistenz, Frieden, gegenseitiger Zuneigung, echter Beteiligung und Solidarität geprägt sein. Wenn wir solche Gemeinschaften aufbauen, werden wir eine Institution geschaffen haben, die in der Lage ist, die heutigen Veränderungen zu bewältigen und zu steuern und dabei in ihren Grundlagen und ihrer missionarischen Dynamik menschlich zu bleiben.
Wir müssen dafür sorgen, dass Einzelne und Gemeinschaften weiterhin Protagonisten der sich vollziehenden Veränderungen sein können, ohne durch neue Komplexitäten und mögliche Ängste gelähmt zu werden.
Gemeinschaften gehen zugrunde, wenn in ihnen Untätigkeit und Gleichgültigkeit vorherrschen. Diese beiden Viren erfordern unsere Aufmerksamkeit.
Die Gemeinschaften, die wir aufbauen wollen, müssen in der Lage sein, sich erneut auf den Weg in die Geschichte von heute und morgen zu machen. Und wenn dies bedeutet, schwierige Situationen oder „Territorien“ zu durchqueren, sollten wir nicht zögern, dies zu tun.
c) Die „jüngste Neuerung“ – vielleicht die größte Herausforderung, aber auch die aufregendste – besteht darin, dass unsere Gemeinschaften heute internationale und interkulturelle missionarische Ordensgemeinschaften sind. Das bedeutet, dass sie für die heutige Evangelisierungsmission besser gerüstet sind. Lassen Sie mich kurz in Erinnerung rufen, was wir in der Aula gesagt haben.
- Prophetisches Zeugnis der Einheit in der Vielfalt – In einer Welt, die von Konflikten, Nationalismus und kulturellen Spaltungen geprägt ist, wird eine Gemeinschaft, die brüderlich lebt, obwohl sie aus Menschen unterschiedlicher Kulturen und Nationen besteht, zu einem konkreten Zeichen des Evangeliums, das Versöhnung, Frieden und Gemeinschaft bezeugen und verkünden kann.
- Fähigkeit zum interkulturellen Dialog – Die Anwesenheit von Mitgliedern mit unterschiedlichem Hintergrund erleichtert es, lokale Mentalitäten zu verstehen, kulturelle Brücken zu bauen und einen respektvollen Dialog mit anderen religiösen und sozialen Traditionen zu führen.
- Gegenseitige Bereicherung – Die tägliche Begegnung zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen fördert den Austausch von Erfahrungen, Spiritualität und missionarischer Sensibilität, der die Gemeinschaft selbst bereichert und sie kreativer und offener macht.
- Größere Glaubwürdigkeit – Interkulturelle Gemeinschaften zeigen, dass das Evangelium nicht einer bestimmten Kultur oder Nation gehört, sondern universell ist. Dies stärkt die Glaubwürdigkeit der Mission, insbesondere in Kontexten, in denen das Christentum als „westlich“ wahrgenommen wird.
- Flexibilität und Anpassungsfähigkeit – Mitglieder mit unterschiedlichem Hintergrund bringen Sprachkenntnisse, historisches Wissen und besondere Sensibilitäten mit, die es ihnen ermöglichen, neuen Herausforderungen (Migration, religiöser Pluralismus, Globalisierung) besser zu begegnen.
- Zeichen der Synodalität – Das gemeinsame Leben und Unterscheiden in der Vielfalt nimmt den Stil der synodalen Kirche vorweg, zu deren Aufbau uns Papst Franziskus einlädt: ein Weg des Zuhörens, des Dialogs und der Mitverantwortung.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine interkulturelle missionarische Gemeinschaft nicht nur das Evangelium verkündet, sondern es in ihrer eigenen Lebensweise verkörpert und selbst Teil der Botschaft des Evangeliums wird.
Was uns bei dieser schwierigen Aufgabe tragen kann, ist nur die Hoffnung! Denn die Hoffnung ist die wertvollste Nahrung einer Gemeinschaft, und diese verbreitet sich nur durch Freundschaft und Solidarität.
- Es gibt eine Mission, die auf uns wartet – Gott sagt uns durch den Mund des Haggai: „Ich werde Himmel und Erde erschüttern … Ich werde alle Völker erschüttern und dieses Haus erfüllen“.
Im Evangelium erinnert uns Petrus jedoch daran, dass es notwendig ist, Partei zu ergreifen, um die Mission Christi zu erfüllen. Und er spricht im Namen der anderen Jünger: „Du bist der Christus Gottes“. Richtige und orthodoxe Worte. Schade, dass er eine Vorstellung von Christus/Messias hat, die nicht mit der des Meisters übereinstimmt. Er wird sich bekehren müssen, um einen gekreuzigten Gesalbten Gottes akzeptieren zu können.
Jeden Tag müssen wir uns fragen: „Wer ist Jesus für mich? Der Sohn Davids oder der Menschensohn? Offensichtlich ist das eine nicht das andere. Wir müssen uns an den Heilsplan des gekreuzigten Christus halten.
Verbieten wir also bestimmte „Exklusiv-Erzählungen“: Christus ist so! Nein, Christus ist so! Christus ist Europäer, Christus ist Afrikaner, Christus ist Lateinamerikaner. Das ist nicht die Art von Empathie, die wir brauchen!
Gemeinsam, als Gemeinschaft und als Institut, müssen wir die Frage Jesu beantworten: „Wer sagt ihr, dass ich bin?“ Unsere Antwort wird bestimmen, auf welcher Seite wir stehen wollen. Und die richtige Seite ist nur eine: die des Friedens, der Wahrheit und der Gerechtigkeit.
Das Manifest von Nazareth, das Jesus verfasst hat, muss das unsere sein. Und das bedeutet, dass wir uns ohne zu zögern auf die Seite der Letzten, der Ausgeschlossenen, der Abgelehnten, der Erschlagenen, der Märtyrer der Gerechtigkeit stellen müssen.
Wir können nicht einfach sagen, was die Welt hören will. Wir müssen sagen, was die Welt hören „muss“, wenn sie mehr und mehr zum Reich Gottes werden soll.
Werden wir uns in Konfliktsituationen wiederfinden? Kein Wunder! Jesus selbst hat es uns vorausgesagt: „Ihr werdet um meines Namens willen gehaßt werden“ (Lk 21,12-19). Wir werden immer verfolgt und von allen gehasst werden, weil wir uns mit Christus identifizieren.
Aber er ermahnt uns zur Beharrlichkeit und zum Durchhaltevermögen und sichert uns die Erlösung zu.
Lassen Sie mich abschließend daran erinnern, was Comboni über die „Parteinahme für Christus“ dachte:
„Angesichts so vieler Bedrängnisse, inmitten von Bergen von Kreuzen und Kummer […] wegen dieser enormen Komplikationen ist das Herz des katholischen Missionars erschüttert. Dennoch darf er nicht den Mut verlieren. Kraft, Mut und Hoffnung dürfen ihn nie verlassen. Ist es überhaupt möglich, dass das Herz eines wahren Apostels angesichts all dieser Hindernisse und außerordentlichen Schwierigkeiten verzagt und ängstlich wird? Nein, das ist nicht möglich, niemals! Nur im Kreuz liegt der Triumph“ (Schriften, 5646).