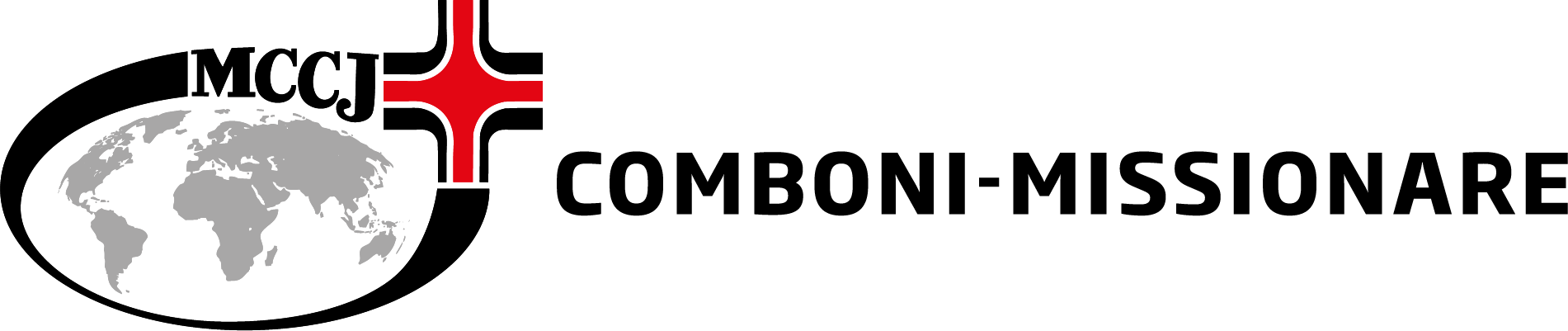Viele Buben aus ganz Südtirol waren in einer Zeit, als es vor fünfzig und sechzig Jahren in den Dörfern am Land fast nur Volksschulen gab, Schüler im Herz Jesu Missionshaus, von wo aus sie die Mittelschule und das Lyzeum besuchen konnten. Es war ein streng geordnetes, religiös geprägtes und für heutige Verhältnisse sehr einfaches Leben, das sie dort erwartete, das ihnen aber auch manche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung bot. Günther Plaikner aus Vintl erzählt uns von seinen Jahren in Milland und von seinem Weg zum Lehrer und zur Weihe zum Diakon.
Dass ich ins Missionshaus Milland kam, verdanke ich der Tatsache, dass bereits vier Buben aus meinem Heimatdorf Niedervintl dort waren. Ich war aber nicht in das Internat abgeschoben worden, sondern wollte selbst zum Studium nach Brixen. Im August 1957 begann ich mit der Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung in die Mittelschule, und am 1. Oktober begann der Unterricht. Ich gehörte als Primaner zu den „Kleinen“, also zu den Mittelschülern, während die Buben von der 4. bis zur 8. Klasse zu den „Großen“ zählten. Jeder Altersgruppe war ein Betreuer als Präfekt zugeteilt. Ich erinnere mich noch an Pater Josef Frank, an Pater Kohnle, an Pater Kirchler, an Pater Schmid, Pater Schmidpeter und an Pater Plankensteiner.

Unser Schulalltag begann, sage und schreibe, bereits um fünf Uhr früh. Beim Erklingen der Glocke hatten wir Buben sofort aus unseren Betten zu springen und uns zur Waschecke zu begeben. Es folgten das Morgengebet, das Morgenstudium im Studiersaal und die heilige Messe in der Kapelle. Zum Frühstück gab es Brennsuppe in einem Blechnapf mit einem kleinen Laib Brot. Nur am Sonntag bekamen wir Milchkaffee. Das Brot, das wir nicht gleich aßen, diente uns zusammen mit zwei Äpfeln als Pausenbrot. Bevor wir uns auf den Schulweg machten, wurde kontrolliert, ob wir wohl die Schuhe geputzt hatten. Wir gingen zu Fuß – und in Reih und Glied. Unser Weg zur Schule dauerte etwa eine halbe Stunde und verlief quer durch Brixen. Ab der 4. Klasse durften wir mit dem Rad fahren.
Wir trafen uns wieder zum Mittagessen gegen 13.15 Uhr. Für uns gekocht wurde von Schwestern nebenan im Ordenshaus. Das Essen musste von zwei Studenten durch einen unterirdischen Gang in unseren Speisesaal im Seminar gebracht werden. Das „Menü“ war Woche für Woche ungefähr gleich. So gab es regelmäßig Schmarrn mit Apfelmus, Knödel, Pellkartoffeln mit Tunfisch, Milchreis, Buchteln mit Kakao, Nudeln mit Tomatensauce und gebackene Mortadella-Schnitten. Es gab ausreichend zu essen. Doch ich muss zugeben, dass mir nicht alles geschmeckt hat, was auf den Tisch kam. Der Nachmittag war in zwei Studierzeiten und in eine Stunde Freizeit aufgeteilt, die je nach Witterung ausgedehnt oder verkürzt wurde. Am späten Nachmittag haben wir dann vor dem Abendessen in der Kapelle den Rosenkranz gebetet. Um 20 Uhr war Bettruhe. In den freien Zeiten haben wir von Frühjahr bis Herbst auf dem Platz hinter dem Heim Fußball gespielt, im Winter wurde dort eine Fläche zum Eislaufen angelegt.
Aus meiner Zeit im Heim bei den Comboni-Missionaren habe ich einiges für mein persönliches Leben mitgenommen. Aus dem streng geregelten Tagesablauf ist mir der Sinn für Ordnung geblieben. Manche Kameradschaften, die dort entstanden sind, haben über Jahre angehalten. Das Missionsseminar bot viele Möglichkeiten zur Entfaltung unserer Talente. Neben dem Studium gab es die Gelegenheit, mit Spiel und Sport die Freizeit zu gestalten. Wir konnten Eislaufen und spielten Fußball, Tischtennis und Schach. Ich lernte Gitarre und Klavier und erprobte mich im Cellospiel. Im Heim gab es eine Bibliothek. Die Karl-May-Bücher waren damals ständig im Umlauf. Es gab einen Chor, der von Theologiestudenten aus dem Ordenshaus geleitet wurde. Ich habe zuerst im Sopran und dann im Tenor und Bass gesungen.
Nach der Matura am wissenschaftlichen Lyzeum in Brixen habe ich dann fünf Jahre bei den der Comboni-Missionaren verbracht und in Mellatz am Bodensee, in Bamberg, Brixen und Würzburg Philosophie und Theologie studiert. Nachdem ich zur Entscheidung gekommen war, dass dies nicht der Weg für mein Leben sein würde, begann ich ein weiteres Studium in Innsbruck und Padua. Mein Interesse galt aber weiter den Comboni-Missionaren. So schrieb ich meine Doktorarbeit in moderner Geschichte über das „Herz-Jesu-Missionshaus“ von seiner Gründung 1895 bis in die Zwischenkriegszeit. Da ich als Religionslehrer in Südtirol keine Anstellung bekam, weil alle Stellen damals (1970) noch von Pfarrern besetzt war, unterrichtete ich dann bis zu meiner Pensionierung an der Mittelschule in Vintl die literarischen Fächer.
Was mein Leben aber auch besonders prägte, war die Weihe zum ständigen Diakon, die ich nach einer dreijährigen Ausbildung am Priesterseminar in Brixen im März 1997 mit vier weiteren Männern von Bischof Wilhelm Egger empfangen durfte. Als Diakon arbeitete ich in den vergangenen 28 Jahren in allen pastoralen Bereichen meiner Pfarrgemeinde. Einmal lag der Schwerpunkt meiner Tätigkeit mehr im Bereich der Caritas, unter anderem in der Mitarbeit bei der Notfall- und Seniorenseelsorge und in der Trauerpastoral, und dann wieder mehr in der Verkündigung in der Vorbereitung auf Taufe, Erstkommunion und Firmung und bei der Predigt und in Bibelrunden. Ich assistierte als Diakon bei der Eucharistiefeier und durfte als Taufspender und Segenspender bei Trauungen wirken. Natürlich bin ich auch bis heute in den verschiedenen Gremien vertreten und helfe in der Pfarrei mit, wo es mich halt braucht. Langsam, langsam versuche ich jetzt Arbeiten abzugeben und selbst mehr in den Hintergrund zu treten. Ich bin ganz davon überzeugt, dass mit Gottes Hilfe und unter seiner Führung tüchtige Frauen und Männer meine Arbeit übernehmen und zum Wohl der Pfarrgemeinde weiterwirken werden.
Dr. Günther Plaikner